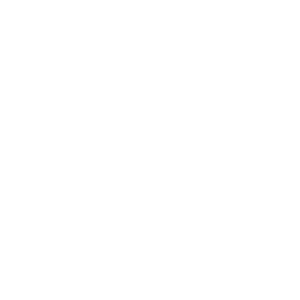Gestalten Sie die Sanierung innerhalb eines gerichtlichen Verfahrens in Eigenregie.
In manchen Fällen stehen Unternehmen vor Herausforderungen, die sie allein nicht bewältigen können. Dabei bieten Krisen eine Möglichkeit zur Restrukturierung und Neuausrichtung des Unternehmens. Wir leisten Unterstützung zur Sanierung von Unternehmen, die die Insolvenz als Chance betrachten und räumen mit dem Stigma des Gescheiterten für den Unternehmer auf.
Das Wichtigste in Kürze
Die Eigenverwaltung erlaubt, dass Unternehmer trotz Insolvenzverfahren weiterhin Entscheidungsträger im Unternehmen bleiben.
- Vorteil: Ein Insolvenzverwalter wird im Fall der Eigenverwaltung nicht eingeschaltet, sodass der Unternehmer den Betrieb selbstbestimmt weiterführen kann.
- Voraussetzung: Damit eine Insolvenz in Eigenverwaltung möglich ist, darf kein Fremdantrag von Gläubigern vorliegen.
- Zudem muss zum Zeitpunkt des Antrags ein nicht offensichtlich aussichtsloses Fortführungs- und Sanierungskonzept vorliegen.
Was ist eine Insolvenz in Eigenverwaltung?
Bei der Eigenverwaltung behält der Schuldner die Kontrolle über sein Unternehmen und kann weiterhin Entscheidungen selbst treffen. Im Gegensatz zum herkömmlichen Insolvenzverfahren, bei dem die Kontrolle vom Gericht an einen Insolvenzverwalter übergeben wird, behält die Geschäftsführung bei der Eigenverwaltung die Kontrolle und die finanzielle Macht. Ein Sachwalter wird vom Gericht hauptsächlich für Überwachungs- und Berichtsaufgaben eingesetzt.
Wann ist eine Insolvenz in Eigenverwaltung sinnvoll?
Ein Eigenverwaltungsverfahren ist in nahezu allen Fällen von haftungsbeschränkten Gesellschaften wie GmbH, GmbH&Co.KG, UG, AG, etc. sinnvoll, sofern die Bruttolohnsumme monatlich jenseits der 50.000€ liegt. Die Insolvenz in Eigenverwaltung stellt also auch für kleinere Unternehmen eine lohnende Option dar. Unternehmer übersehen oft die vielfältigen Aufgaben, die ein Eigenverwalter während eines Insolvenzverfahrens hat. Daher besteht in jedem Unternehmen die Gefahr, dass das Tagesgeschäft und die Sanierungsbemühungen darunter leiden. Aber mit der notwendigen Anstrengung und professioneller, auf die Ansprüche von KMUs angepasster Unterstützung durch einen Sanierungsberater laufen Eigenverwaltungen in kleinen und großen Unternehmen sehr gut.
Vorteile der Insolvenz in Eigenverwaltung
Bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung bleibt die Geschäftsführung des Schuldners in der Verantwortung und trifft Entscheidungen für das Unternehmen. Im Gegensatz zur Regelinsolvenz ist bei der Eigenverwaltung kein Insolvenzverwalter beteiligt.
Erhaltung der operativen Geschäftstätigkeit
Die Unternehmensleitung leitet die Umstrukturierung mit Hilfe eines Sanierungsberaters ein, in der Regel einesGeneralhandlungsbevollmächtigten oder eines Chief Restructuring Officer (CRO). Dieser berät und unterstützt das Management bei der Vorbereitung und Durchführung der Sanierung. Dadurch wird das Vertrauen in die Eigenverwaltung und bei den Gläubigern gestärkt.
Mehr Einflussmöglichkeiten für das Unternehmen
Das Unternehmen wird seine derzeitigen Vertreter für die Außendarstellung beibehalten, wodurch sich negative Auswirkungen auf sein Image in dieser schwierigen wirtschaftlichen Situation mindern.
Voraussetzungen für die Insolvenz in Eigenverwaltung
Damit eine Insolvenz in Eigenverwaltung möglich ist, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt werden.
- Das Unternehmen hat einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Es darf kein Fremdantrag bestehen.
- Es muss sich um eine Unternehmensinsolvenz handeln. Die Eigenverwaltung ist bei Verbraucherinsolvenzen nicht möglich.
- Ein Fortführungs- und Sanierungskonzept liegt vor.
- Dem Gericht liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Gläubiger bei der Eigenverwaltung gegenüber einem herkömmlichen Insolvenzverfahren benachteiligt werden.
Bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung besteht die größte Herausforderung darin, dem Gericht und den Gläubigern zu beweisen, dass das Unternehmen den Weg aus der Insolvenz erfolgreich bewältigen und wieder wettbewerbsfähig werden kann. Es ist von entscheidender Bedeutung, frühzeitig einen Insolvenzantrag zu stellen, wenn noch Geld für die Umstrukturierung zur Verfügung steht und eine Sanierung machbar erscheint. Üblicherweise werden Unternehmensberater mit der Erstellung der erforderlichen Berichte und Prognosen beauftragt, was sehr kostspielig sein kann.
Je früher sich der Unternehmer entscheidet, um so günstiger werden die Kosten für das Verfahren.
Ablauf der Insolvenz in Eigenverwaltung
Vor der Beantragung einer Insolvenz in Eigenverwaltung ist es wichtig, das Unternehmen ordnungsgemäß vorzubereiten. Sobald der Sanierungsplan fertiggestellt ist, kann der Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung bei Gericht eingereicht werden.
Vorbereitungen
Damit einer Eigenverwaltung zugestimmt wird, muss das Unternehmen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Diese Anforderungen sind in § 270 b der Insolvenzordnung festgelegt. Wenn nicht alle Anforderungen erfüllt sind, muss man sich vorrangig um diese kümmern. Dazu gehören die Veröffentlichung von Handelsbilanzen und die Sicherstellung einer aktuellen Buchführung.
- Plan für die Eigenverwaltung erstellen: Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Unternehmen einen Unternehmensplan für die Eigenverwaltung haben müssen. Dieser Plan umfasst eine Gewinnplanung, eine Liquiditätsplanung und eine Planbilanz. Der Plan berücksichtigt, wie sich die Eigenverwaltung auf den Erfolg und die Liquidität des Unternehmens auswirken wird. In seltenen Fällen ist auch ein IDW S6-Gutachten notwendig.
- Aktuelle Buchhaltung: Eine aktuelle Buchhaltung ist die Voraussetzung für einen verlässlichen Businessplan. Plausibilität kann nur mit einer aktuellen Buchhaltung erreicht werden. Die Handelsbilanz muss vorhanden sein, aber nicht unbedingt der Jahresabschluss.
Antragstellung
Ist ein Unternehmen für die Eigenverwaltung bereit, wird ggfs. der Insolvenzrichter informiert und ein Vorbesprechungstermin zur Vertrauensbildung vereinbart. Dabei stellt der Sanierungsberater den Sanierungsplan vor. Dabei können auch die Besonderheiten des Falles besprochen und in den Plan eingearbeitet werden.
- Der Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung wird in aller Regel beim Gericht digital über das neue gerichtliche E-Mail-System BeA eingereicht.
- Manchmal wird vom Insolvenzgericht ein Sachverständiger bestellt, bevor die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet wird. Dieser Sachverständige wird zu einem späteren Zeitpunkt Sachwalter oder Insolvenzverwalter. Seine Aufgabe besteht in der Prüfung, ob die Voraussetzungen für die Eigenverwaltung erfüllt sind. Diese Prüfung dauert in der Regel einige Tage, bevor die Eigenverwaltung genehmigt werden kann.
- Laut § 22 a InsO setzt das Gericht einen vorläufigen Gläubigerausschuss ein, wenn zwei der drei folgenden Größenmerkmale erfüllt sind:
- eine Arbeitnehmerzahl über 50
- eine jährliche Bilanzsumme von mehr als 6 Millionen Euro
- ein Umsatz von mehr als 12 Millionen Euro
- Es kann auch auf Wunsch des Unternehmens ein freiwilliger Gläubigerausschuß eingerichtet werden, was in manchen Fällen strategisch klug sein kann.
Vorläufige Eigenverwaltung
Der Restrukturierungsprozess beginnt mit der vorläufigen Eigenverwaltung, die in der Regel zwei bis drei Monate dauert, und in der neue Liquidität geschaffen und der Geschäftsbetrieb stabilisiert wird.
- Arbeitnehmer erhalten im Rahmen der vorläufigen Eigenverwaltung Insolvenzgeld. Der Sanierungsberater wickelt das Verfahren ab und stellt sicher, dass die Arbeitnehmer drei Monate lang ihren Nettolohn erhalten. Um das Verfahren zu beschleunigen, wird das Insolvenzgeld über eine Bank vorfinanziert, da das Arbeitsamt erst nach der Eröffnung des Verfahrens auszahlen kann. Diese Vorfinanzierung stellt sicher, dass die Arbeitnehmer 100 % ihres Lohns erhalten, ohne dass sie das Arbeitsamt aufsuchen müssen.
- Der Sachwalter wird die Eigenverwaltung regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Gläubigerinteressen und finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren berücksichtigt werden. Es wird ein Insolvenzbuchhaltungssystem eingerichtet, um Einnahmen und Ausgaben getrennt von der regulären Buchhaltung zu erfassen und dem Sachwalter wöchentliche Berichte vorzulegen.
- Eine Pressemitteilung wird für Unternehmen mit regionaler Bedeutung empfohlen, um Gerüchten vorzubeugen. Sie ist auch für Mitarbeiter von Vorteil, die mit Lieferanten und Kunden zu tun haben. Die Pressemitteilung dient als Orientierungshilfe für die Mitarbeiter und hilft, schwierige Diskussionen mit Kunden und Lieferanten zu vermeiden.
- Nach der Einrichtung der Eigenverwaltung beginnen die Verhandlungen mit Banken, Lieferanten und Kunden. Die Sicherheitsinteressen der Gläubiger, wie Eigentumsvorbehalt und Globalzession, müssen berücksichtigt werden. Die Lieferanten verlangen möglicherweise Vorauszahlungen und die Kunden die Zusicherung einer kontinuierlichen Belieferung.
- Die Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens ist für alle Beteiligten eine schwierige Zäsur, durch die das Vertrauen verloren gehen kann. Die Geschäftsführung muss sich darauf konzentrieren, das Vertrauen aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen, was bei der Eigenverwaltung im Vergleich zur Regelinsolvenz normalerweise einfacher ist, weil alle Ansprechpartner erhalten bleiben.
Eigenverwaltung
Im Mittelpunkt des Hauptverfahrens stehen die Gläubiger. Es wird eine besondere Prüfung durchgeführt, um die Forderungen der einzelnen Gläubiger gegenüber dem Unternehmen zu ermitteln. Diese Informationen werden für die anschließende Verteilung der Insolvenzquote verwendet. In der Zwischenzeit kann die Geschäftsführung den Betrieb wie gewohnt weiterführen. Mit kurzen Kündigungsfristen für Verträge aller Art kann sich das Unternehmen erholen und zu einem gesunden Zustand zurückkehren.
- Das Unternehmen hat wieder die vollen Kosten zu tragen. Während der vorläufigen Eigenverwaltung hatte das Unternehmen nur minimale Ausgaben. Löhne wurden in dieser Phase nicht, Leasingraten und Mieten meist nicht vollständig gezahlt. Diese Schonfrist ist nun jedoch abgelaufen und das Unternehmen muss alle bestehenden Verträge wieder bezahlen und erfüllen.
- In der Eigenverwaltung hat ein Unternehmen den Vorteil, dass es Verträge einseitig und fristlos kündigen kann. Dies wird als Erklärung der Nichterfüllung eines Vertrages nach § 103 InsO bezeichnet. Ausnahmen gibt es allerdings bei Arbeits- und Mietverträgen, die eine dreimonatige Kündigungsfrist erfordern. Diese Sonderkündigungsrechte ermöglichen es dem Unternehmen, unrentable Verträge zwecks Sanierung zu beenden.
- Die Gläubiger müssen ihre Forderungen beim Sachwalter anmelden, damit sie am Insolvenzverfahren teilnehmen. Das Insolvenzgericht prüft die Gültigkeit der Forderung. Wird die Forderung anerkannt, wird sie als „festgestellt“ in die Insolvenztabelle eingetragen. Damit kann der Gläubiger seinen Teil der im Insolvenzplan ausgewiesenen Quote erhalten.
- Etwa 2 Monate nach der Eröffnung des Hauptverfahrens findet ein Berichtstermin statt, um den Stand der Sanierung zu erörtern. In diesem Termin berichtet der Sanierungsberater und der Sachwalter den Gläubigern über den Verlauf der Restrukturierung und gibt eine Prognose ab, wie das Verfahren zur bestmöglichen Befriedigung der Gläubiger abgeschlossen werden soll. Die Gläubiger werden dann über die Beibehaltung der Eigenverwaltung abstimmen.
- Die Fortsetzung der Verhandlungen mit den wichtigsten Gläubigern ist in fast jedem Eigenverwaltungsverfahren von entscheidender Bedeutung. Einflussreiche Gläubiger, wie z. B. eine Bank, die die größten Schulden mit Sicherungsrechten hält, können den Umstrukturierungsprozess beeinflussen. Es ist wichtig, positive Beziehungen zu diesen Gläubigern zu pflegen.
- Alle steuerlichen Fragen sollten im Hauptverfahren geklärt werden, damit das Finanzamt Steuerforderungen zur Insolvenztabelle anmelden kann. Dazu gehören die Vorsteuerberichtigung und die Umsatzsteuerberichtigung. Es müssen Jahresabschlüsse erstellt werden. Die Nichterledigung dieser Aufgaben kann dazu führen, dass das Finanzamt den Insolvenzplan später ablehnt.
Beendigung der Eigenverwaltung
Nach Klärung aller Gläubigerrechte kann die Insolvenz in Eigenverwaltung mit Hilfe eines Insolvenzplans beendet werden. Dieser Plan ist im Wesentlichen eine ausgehandelte Vereinbarung mit den Gläubigern über einen Teilzahlungsvergleich. Die Gläubiger erklären sich bereit, eine machbare Quote zu erhalten und auf die Restschuld zu verzichten. Dies führt dazu, dass das Unternehmen schuldenfrei wird und seine Zahlungsfähigkeit wiedererlangt.
- Der Insolvenzplan kann auch gegen die Einwände einzelner Gläubiger durchgesetzt werden. Das Verfahren für den Insolvenzplan wird vom Gericht genau überwacht, wobei die Abstimmung über den Plan in der Regel in einer mündlichen Verhandlung vor Gericht erfolgt.
- Der Insolvenzplan kann neben der Ausgestaltung des Schuldenschnitts auch die Rechte der Gesellschafter neu regeln. Die Anteile der Gesellschafter können im Rahmen des Plans neu verteilt werden, wobei die bisherigen Anteilseigner wie die Gläubiger eine Quote erhalten. Neue Anteilseigner können sich ebenfalls beteiligen, um den Kapitalschnitt zu vervollständigen.
- Nach Abschluss des Verfahrens wird der Insolvenzplan vom Gericht bestätigt und rechtskräftig. Die Quote wird dann unter den Gläubigern verteilt. Das Unternehmen trägt die Kosten für den Sachwalter und das Gericht. Danach ist das Insolvenzverfahren beendet und das Unternehmen von seinen bisherigen Schulden befreit.
Wie kann ich die Insolvenz in Eigenverwaltung durchführen?
Einen Insolvenzantrag können die Geschäftsführer stellen.
Was kostet die Insolvenz in Eigenverwaltung?
Die Kosten der Eigenverwaltung können variieren und werden vom Unternehmen getragen. Es ist Voraussetzung für die Anordnung, dass die Eigenverwaltung nicht teurer als ein herkömmliches Regelinsolvenzverfahren sein darf.
Welche Alternativen gibt es zur Insolvenz in Eigenverwaltung?
Bevor es zu einer Insolvenz in Eigenverwaltung kommt, sollte man andere Möglichkeiten prüfen.
Außergerichtliche Sanierung
Bei der außergerichtlichen Sanierung kann sich das krisengeschüttelte Unternehmen mit seinen Gläubigern auf eine Ratenzahlung oder einen (prozentualen) Schuldenschnitt einigen. Alternativ können Investoren dem Unternehmen eine Finanzierung auf der Grundlage eines Sanierungsplans anbieten. Eine außergerichtliche Umstrukturierung setzt voraus, dass keine Pflicht zur Insolvenzantragstellung vorliegt. Besteht eine solche Verpflichtung, müssen Schritte unternommen werden, die die Weiterführung des Unternehmens gewährleisten. Zum Nachweis der Fähigkeit des Unternehmens zur Sanierung sollte ein Sanierungskonzept entwickelt werden.
Für die Gewährung von Sanierungskrediten durch Banken oder die Teilnahme öffentlicher Gläubiger an außergerichtlichen Vergleichen ist in aller Regel ein Sanierungsgutachten nach IDW S6 erforderlich. Die Zuführung von Liquidität und ein „Schuldenschnitt“ wirken sich nur auf den finanziellen Aspekt der Umstrukturierung aus. Eine leistungsorientierte Umstrukturierung ist für die meisten Unternehmen unerlässlich, um in Zukunft eine stabile Wettbewerbsposition zu erreichen.
StaRUG
Sofern möglich, sollte man das Restrukturierungsverfahren nach dem neuen StaRUG anstelle des Schutzschirmverfahrens vorziehen. Das Sanierungsverfahren ist weniger invasiv und betrifft nur vom Unternehmer ausgewählte Gläubiger, während andere, wie z.B. Lieferanten, meist nicht betroffen sind. Im Gegensatz dazu sind beim Schutzschirmverfahren alle Gläubiger betroffen. Außerdem ist das Restrukturierungsverfahren trotz gerichtlicher Beteiligung privat, so dass die Unternehmensleitung die volle Kontrolle über den Prozess behält.
Schutzschirmverfahren
Besteht lediglich drohende Zahlungsunfähigkeit nach § 18 InsO, ist ein Schutzschirmverfahren möglich. Das Schutzschirmverfahren nach § 270 d InsO ist ein gerichtliches Sanierungsverfahren für finanziell angeschlagene Unternehmen. Auch hier wird ein Insolvenzplan erstellt, der einen Schuldenschnitt vorsieht. Die Gläubiger erhalten eine kleine Zahlung, und die restlichen Schulden werden erlassen, was dem finanziell angeschlagenen Unternehmen durch die Krise hilft. Allerdings darf das Unternehmen hier den Sachwalter bestimmen und ein M&A-Prozess ist nach herrschender Meinung nicht erforderlich.
Herausforderungen bei Insolvenz in Eigenverwaltung
Jeder Unternehmer kann theoretisch die Eigenverwaltung beantragen. Allerdings stellen sich verschiedene Herausforderungen, die dieses Vorhaben behindern können.
Vertrauensverlust bei Gläubigern
Wenn Bedenken bestehen, dass der Schuldner das Eigenverwaltungsverfahren missbrauchen könnte, um den Gläubigern zu seinem eigenen Vorteil zu schaden, wird die Eigenverwaltung abgelehnt. Solche Bedenken können in folgenden Situationen entstehen:
- Das Unternehmen hat seit mehreren Jahren keine effektiven Jahresabschlüsse mehr erstellt.
- Der Insolvenzantrag enthält unrichtige Angaben zum Vermögen des Unternehmens.
- Der Schuldner täuscht das Gericht über seine geplanten Entnahmen im Rahmen des Eigenverwaltungsverfahrens.
- Die Beziehungen zwischen Unternehmen innerhalb von Konzernen sind nicht transparent.
- Es liegt eine Verzögerung bei der Insolvenzanmeldung vor.
- Geschäftsführer sind in der Regel bestrebt, Haftungsansprüche zu vermeiden.
- Bei der Eigenverwaltung werden häufig Informations- und Mitwirkungspflichten verletzt.
Wie geht es nach der Insolvenz in Eigenverwaltung weiter?
Das Unternehmen ist nun frei von allen Schulden und Verpflichtungen, die nicht speziell mit dem vorgelegten Plan zusammenhängen. Dies ermöglicht dem Unternehmen wieder volle Handlungsfreiheit. Je nach Situation können noch weitere Schritte erforderlich sein, wie etwa:
- das Handling von Nachzügler-Gläubigern, die ihre Ansprüche erst nach Verfahrensaufhebung geltend machen.
- Auseinandersetzungen mit Sozialversicherungsträgern oder anderen Gläubigern.
- Die Auszahlung der im Plan zugesagten Quote.
Die Wiederherstellung der Bonität des Unternehmens bei den einschlägigen Ratingagenturen ist ein wichtiges und sensibles Thema, bei dem wir gerne unterstützen. Auch in diesem Zeitraum stehen wir Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.